Regionalbewusstsein im Ruhrgebiet?
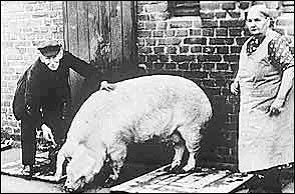
Zechenkolonie: Spuren der bäuerlichen Herkunft
Quelle: RVR-Fotoarchiv
Quelle: RVR-Fotoarchiv
Erst um die Jahrhundertwende kam es unter dem Einfluss von Bergbau, Groß- und Schwerindustrie, Technik und Massenzuwanderung zur Ausbildung übergreifender regionalkultureller Gemeinsamkeiten, die das Ruhrgebiet gleichzeitig immer stärker von ihrer westfälischen und rheinischen Umwelt abhoben.

Schrebergartenidylle im Ruhrgebiet
Quelle: RVR-Fotoarchiv
Quelle: RVR-Fotoarchiv
Mit dem Rückzug der Montanindustrie entstanden zwischen dem sich verstärkenden schwerindustriellen Negativ-Image, der traditionellen Alltagskultur und der bürgerlichen Hochkultur unüberbrückbare Gräben.
- Vertiefung: Alltagskultur und Vereinsleben

Trinkhalle an der Wattenscheider Straße in Bochum (2003)
Quelle: Autorenteam
Quelle: Autorenteam
Es besteht sicherlich die Bereitschaft, sich auf eine Ruhrgebietskultur einzulassen, vielleicht aber mehr noch: das Bedürfnis nach identifikationsstiftender symbolischer Regionsbezogenheit. Es reicht von Rockmusik (Herbert Grönemeyer) über Kabarett (Dr. Stratmann), Film/Fernsehen (Schimanski), Szene (Zeche Carl, Bermuda-Dreieck) bis zum Fußball ("Ruhrpott! Ruhrpott!", s.u.) und vom Bergbau über das Rheinische und Westfälische Industriemuseum, Groß-Ausstellungen (z.B. "Feuer und Flamme") bis zur RuhrTriennale.
Die materiellen Grundlagen der einstigen Soziokultur sind (fast) verschwunden. Kohle und Stahl fungieren kaum noch als Bindeglied der alltäglichen Lebenswelt. Auflösungs- und Abgrenzungserscheinungen machen sich vor allem an den Rändern der Region bemerkbar (s.u.). Teile des Ruhrgebietes haben sich - unterstützt von der regionalisierten Strukturpolitik (s. Thema "Strukturpolitik für das Ruhrgebiet") - zu Interessenverbänden zusammengeschlossen (z.B. die Emscher-Lippe Agentur). Das ist Ausdruck der Tatsache, dass die Kommunen bzw. Gemeinde-Gruppen zumindest in einigen Bereichen sehr verschiedene Probleme und Interessenlagen besitzen (Rohe, 2001).
Ist also die Frage "Gibt es noch ein Ruhrgebiet?" berechtigt, die eine Untersuchung aus dem Jahr 2001 aufwirft (Schrumpf/Budde/Urfrei 2001)?
Die materiellen Grundlagen der einstigen Soziokultur sind (fast) verschwunden. Kohle und Stahl fungieren kaum noch als Bindeglied der alltäglichen Lebenswelt. Auflösungs- und Abgrenzungserscheinungen machen sich vor allem an den Rändern der Region bemerkbar (s.u.). Teile des Ruhrgebietes haben sich - unterstützt von der regionalisierten Strukturpolitik (s. Thema "Strukturpolitik für das Ruhrgebiet") - zu Interessenverbänden zusammengeschlossen (z.B. die Emscher-Lippe Agentur). Das ist Ausdruck der Tatsache, dass die Kommunen bzw. Gemeinde-Gruppen zumindest in einigen Bereichen sehr verschiedene Probleme und Interessenlagen besitzen (Rohe, 2001).
Ist also die Frage "Gibt es noch ein Ruhrgebiet?" berechtigt, die eine Untersuchung aus dem Jahr 2001 aufwirft (Schrumpf/Budde/Urfrei 2001)?

